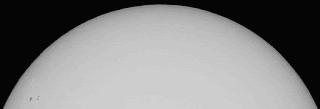Wie die Dragonfly eigentlich aussehen soll und was sich die NASA mit ihr zu finden erhofft, wird Ihnen unser Referent Andreas Möhn am 05.05. um 20:00 Uhr in der Franz-Kaiser-Sternwarte Wiesbaden vorstellen.
Samstag, 3. Mai 2025
Nächster Vortrag: "Dragonfly: ein Hubschrauber im Saturnsystem", Mo., den 5.5.2025 - Referent: Andreas Möhn
Wie die Dragonfly eigentlich aussehen soll und was sich die NASA mit ihr zu finden erhofft, wird Ihnen unser Referent Andreas Möhn am 05.05. um 20:00 Uhr in der Franz-Kaiser-Sternwarte Wiesbaden vorstellen.
Freitag, 2. Mai 2025
Der Himmel im April 2025 (2)
ISS-Transit vor der Sonne
in der Sternwarte am 11.4.2025 um 10:07 Uhr
 |
| Bild 1: Simulation/Vorhersage der ISS und ihrer Bahn mit "Stellarium". Die Sonnenflecken sind nur ein Symbolbild. |
 |
| Bild 2, Einzelbild mit Ausschnittvergrößerung |
 |
| Bild 3, „Mehrfachbelichtung“ der Sonne mit der ISS. |
Dienstag, 29. April 2025
Der Himmel im April 2025 (1)
 |
| 01.04.2025, 22:26 Uhr, 1,6 s. Bei ISO 200, 350 mm, F 4,8 (Kamera CANON EOS 350D) |
 |
| 01.04.2025, 23:53 Uhr, 2,5 s. Bei ISO 200, 350 mm, F 4,8 (Kamera CANON EOS 350D) |
Eine Woche später erfasste Kai-Uwe am Morgenhimmel den Kometen C/2025 F2 (SWAN). Dieser Komet war erst eine Woche zuvor entdeckt worden und hielt durch die Sternbilder Pegasus und Andromeda auf die Sonne zu. Erste Meldungen, nach denen er im Mai mit bloßem Auge zu sehen sein könnte, mussten leider zurückgenommen werden, da der Komet bei der Annäherung an die Sonne auseinander brach und sich auflöste.
 |
| 08.04.2025, 04:52 Uhr, 34 x 30 s, Bei ISO 800, 200 mm, F/5, Helligkeit etwa 8.5 mag, bearbeitet mit Fitswork, Ausschnitt aus dem Originalbild. |
Sonntag, 27. April 2025
Nächster Beobachtungsabend: Mo, den 28.04.2025, 20:00 - 22:00 Uhr
Samstag, 19. April 2025
Frohe Ostern aus der Franz-Kaiser-Sternwarte in Wiesbaden
Freitag, 4. April 2025
Nächster Vortrag am Mo., 07.04., um 20 Uhr: „Die Magellanschen Wolken – unsere Nachbargalaxien“, Dr. Peter Sattelberger
 |
| Das Bild zeigt links die Kleine Magellansche Wolke und rechts die Große Magellanische Wolke, in der am 24.02.1987 die Supernova mit der Bezeichnung SN 1987 A aufleuchtete |
Sonntag, 30. März 2025
Nächster Beobachtungsabend: Mo., den 31.03.2025 um 20:00 Uhr
 |
| Die verfinsterte Sonne beim Maximum um 12:10 Uhr des 9.03.2025. CANON EOS 600D, 1/4000 s, ISO 100 (kein Sonnenfilter), 350 mm, F/4.8 |
So richtig ideal waren die Bedingungen zur gestrigen partiellen Sonnenfinsternis zwar nicht, aber zumindest konnte man auch ohne Schutzfilter ein paar Aufnahmen gewinnen, wie das obige Beispiel unseres Mitglieds Kai-Uwe Wehrheim zeigt.
Wenn Sie wissen wollen, wann die nächste Finsternis für Hessen zu erwarten ist - und hoffentlich dann bei klarem Himmel -, dann kommen Sie doch am Montag, dem 31.03., in die Franz-Kaiser-Sternwarte an der Bierstadter Straße in Wiesbaden! Wir führen Ihnen gerne vor, was zu erwarten ist, und wenn es aufklaren sollte, dann können Sie auch noch mit unseren Instrumenten beobachten.
Natürlich wird es wegen der Sommerzeit jetzt abends eine Stunde später dunkel. Hoffentlich haben Sie alle Uhren schon umgestellt, die es nicht selber tun?